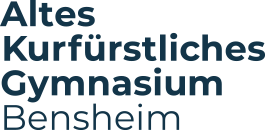Dr. Fritz Bockius (1882–1945) – Reichstagsabgeordneter für die Zentrumspartei von 1924-1933
 Berlin. 23. März 1933, kurz nach 19 Uhr: Hermann Göring ruft als Präsident des Reichstages das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, besser bekannt als Ermächtigungsgesetz, zur Abstimmung auf. In den Beratungen zuvor hatte sich Otto Wels für die SPD zu den Grundsätzen des Rechtsstaates, der Gleichberechtigung, des sozialen Rechtes, (…) den Grundsätzen der Menschlichkeit und der Gerechtigkeit bekannt. Wie würde sich das Zentrum, das zusammen mit der SPD die Weimarer Republik lange Zeit getragen hatte, in dieser Abstimmung verhalten? Eines der führenden Mitglieder der Reichstagsfraktion des Zentrums war Fritz Bockius, ehemaliger Schüler am Bensheimer Gymnasium, dem heutigen AKG.
Berlin. 23. März 1933, kurz nach 19 Uhr: Hermann Göring ruft als Präsident des Reichstages das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, besser bekannt als Ermächtigungsgesetz, zur Abstimmung auf. In den Beratungen zuvor hatte sich Otto Wels für die SPD zu den Grundsätzen des Rechtsstaates, der Gleichberechtigung, des sozialen Rechtes, (…) den Grundsätzen der Menschlichkeit und der Gerechtigkeit bekannt. Wie würde sich das Zentrum, das zusammen mit der SPD die Weimarer Republik lange Zeit getragen hatte, in dieser Abstimmung verhalten? Eines der führenden Mitglieder der Reichstagsfraktion des Zentrums war Fritz Bockius, ehemaliger Schüler am Bensheimer Gymnasium, dem heutigen AKG.
Abitur im Jahr 1900
50 Jahre zuvor: Fritz Bockius wird als fünftes Kind streng gläubiger katholischer Eltern am 11. Mai 1882 in Bubenheim geboren. Bubenheim lag damals in der zu Hessen gehörenden Provinz Rheinhessen. Nach der achtjähriger Volksschule in Bubenheim besuchte Fritz auf Rat des örtlichen Pfarrers zunächst das Progymnasium in Dieburg, später das Gymnasium in Bensheim. Nach dem Abitur im Jahr 1900 studierte Bockius in Mainz sieben Semester katholische Theologie. Der Weg zum Priester war vorgezeichnet. Bockius fühlte sich jedoch immer weniger dazu hingezogen, brach sein Theologiestudium ab und studierte zunächst Philosophie in Gießen. Das sagte ihm jedoch ebenfalls nicht zu, so dass er schließlich Jura studierte und 1908 die juristische Staatsprüfung bestand. Im gleichen Jahr promovierte er über Die strafrechtliche Bedeutung der internationalen Verträge über das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst.
Für die Zentrumspartei im Reichstag
Bockius ließ sich 1912 als Rechtsanwalt in Mainz nieder. Sein Engagement für die Anliegen sozial schwacher Schichten ließen ihn schnell zu einem gefragten und gesuchten volkstümlichen Strafverteidiger werden. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wandte sich Dr. Bockius der Politik zu, die Zentrumspartei wurde für ihn zur politischen Heimat. Ab 1919 vertrat er diese Partei als Abgeordneter im Kreistag, 1920 wurde er zum Landesvorsitzenden der hessischen Zentrumspartei gewählt. Ab 1924 war Dr. Bockius Reichstagsabgeordneter der Zentrumspartei.
Nachdem die NSDAP bei den Reichstagswahlen 1930 zweitstärkste Kraft im Reichstag geworden war, versuchte Reichskanzler Heinrich Brüning (Zentrum) die Möglichkeit einer Kooperation mit der NSDAP auszuloten. Hessen bot sich als Experiment an, da dort Landtagswahlen ins Haus standen. Fritz Bockius wurde beauftragt, den Kontakt zur NSDAP in Hessen herzustellen, wofür er gut geeignet schien, da sein Verhandlungspartner bei der NSDAP, Dr. Werner Best, vier Jahre lang in Bockius’ Mainzer Notariat gearbeitet hatte. Mitten in die Verhandlungen platzten allerdings die Boxheimer Dokumente – benannt nach einem kleinen Gut zwischen Bürstadt und Lampertheim: Sie enthielten Putschpläne der NSDAP, konterkarierten so deren Legalitätskurs. Autor dieser Dokumente war Werner Best, Bockius’ Gesprächspartner, sodass weitere Sondierungen nicht denkbar waren, schon deswegen nicht, weil gegen Best anschließend wegen Hochverrats ermittelt wurde.
Erst als 1932 die NSDAP bei den Landtagswahlen in Hessen mit 44% stärkste Partei wurde, kam es erneut zu Verhandlungen, an deren Ende am 13. März 1933 – 10 Tage vor dem Ermächtigungsgesetz – der NSDAP-Politiker Ferdinand Werner mit den Stimmen des Zentrums zum neuen Staatspräsidenten Hessens gewählt wurde.
Als der am 30. Januar 1933 von Reichspräsident von Hindenburg zum Reichskanzler ernannte Adolf Hitler trotz der Terrormaßnahmen der sogenannte Reichstagsbrandverordnung bei den Reichstagswahlen vom 5. März 1933 mit der NSDAP die absolute Mehrheit verfehlte, legte er dem Reichstag das sogenannte Ermächtigungsgesetz vor. Es sollte das Parlament ausschalten, die Verfassung de facto außer Kraft setzen und der Reichsregierung, also Hitler, die Macht im Staat übertragen.
Gegner des Ermächtigungsgesetzes
In der Sitzungspause wurde auch in der Zentrumsfraktion diskutiert: Ebenso wie der ehemalige Reichskanzler Dr. Heinrich Brüning bezog auch Fritz Bockius gegen das Ermächtigungsgesetz Stellung und kündigte seine Weigerung an, dem Gesetz seine Zustimmung zu erteilen. Die Mehrheit in der Zentrumspartei war aber bereit, dem Gesetz zuzustimmen. Letzten Endes unterwarfen sich Brüning, Bockius und alle anderen parteiinternen Kritiker dem Fraktionszwang und stimmten wider ihre Überzeugung mit Ja.
Nachdem sich das Zentrum auf Druck der NSDAP am 5. Juli 1933 als letzte Partei selbst aufgelöst hatte, widmete sich Fritz Bockius wieder seiner Anwaltskanzlei in Mainz. Als ehemaliger Zentrumspolitiker wurde er nun jedoch von vielen Klienten gemieden. Seit Februar 1942 vertrat Bockius mehrmals pro Woche den Bensheimer Rechtsanwalt und Notar Albrecht Hartmann in dessen Bensheimer Kanzlei. Als nach einem Fliegerangriff 1942 das Haus der Familie Bockius in Mainz zerstört wurde, siedelte er mit seiner Familie nach Bensheim um.
1944 im KZ
Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 ließ das NS-Regime in der Aktion Gewitter ehemalige Angehörige der demokratischen Parteien der Weimarer Republik inhaftieren, darunter auch Fritz Bockius, der am 23. August 1944 um 5.30 Uhr morgens verhaftet wurde und in das Rundeturmgefängnis in Darmstadt gebracht wurde. Im Dezember 1944 wurde Bockius zunächst in das KZ Sachsenhausen-Oranienburg verlegt, im Februar 1945 in das KZ Mauthausen, wo er am 5. März 1945 starb.
Mit einem Denkmal vor dem Berliner Reichstag wird an die 96 von den Nationalsozialisten zwischen 1933 und 1945 ermordeten Reichstagsabgeordneten erinnert. Wer die Namen durchliest, stellt schnell fest, dass fast alle Opfer den linken Parteien SPD oder KPD angehörten, nur 10 Opfer waren Mitglieder bürgerlicher Parteien. – Fritz Bockius war eines von ihnen.
(Andreas Brückmann)