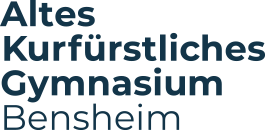Kindheit und Jugend
Krauß wurde am 9. Januar 1810 in Fürth im Odenwald als Sohn eines katholischen Amtmannes geboren. Er besuchte das Gymnasium in Bensheim und zeichnete sich dort 1825 als „Preisträger der dritten Klasse […] im Griechischen, in der Mathematik und in der Geschichte“ aus. Krauß immatrikulierte sich am 13. November 1828 an der Universität Gießen für das Studium der Medizin. Bis zum Wintersemester 1830/31 studierte er in Gießen, vom Sommersemester 1831 bis einschließlich Sommersemester 1832 in Heidelberg und im Wintersemester 1832/33 erneut in Gießen. Am 6. Juni 1833 schloss er sein Studium mit der Erlangung des medizinischen Doktorgrads ab.
Arzt in Bensheim und Mitgründer des Bensheimer Gewerbevereins
Danach wirkte er in Bensheim als praktischer Arzt, aber auch als Armen- und Hospitalarzt sowie als so genannter Seminararzt am Lehrerseminar. Seit 1843 bis mindestens 1857 war Krauß Mitglied des Bensheimer Ortsschulvorstandes, der in Hessen seit 1832 aus dem Ortspfarrer, dem Bürgermeister und zwei honorigen Bürgern bestand. Der Ortsschulvorstand war ausschließlich für das Volksschulwesen bzw. alle Schulen, die keinen weiterführenden Charakter hatten, zuständig. 1844 gehörte Krauß zu den Gründern des Bensheimer Gewerbevereins. Als Vorsitzender dieses Vereins und als Mitglied des Ortsschulvorstandes kümmerte er sich sowohl um Gewerbepolitik als auch um Schul- und Bildungsfragen. Er soll schon 1843 einen Kinderschulverein gegründet haben; jedenfalls ist sein Engagement für die Gründung eines Kindergartens schon vor 1848 vielfältig belegbar. Zusammen mit anderen Bensheimern organisierte er ab 1846 den Bau des Kirchberghäuschens.
Die Revolution von 1848
Im März 1848 mischte sich Krauß unmittelbar in die politischen Auseinandersetzungen der Revolutionszeit ein. Dabei lag ihm als Vorsitzendem des Gewerbevereins am Herzen, „die Ursachen des Verfalles der Gewerbe näher zu besprechen und die Mittel und Wege zur Abhülfe und zur Hebung des Gewerbestandes überhaupt [zu] beraten.“ Am 24. Februar 1849 gründete er in Bensheim den Vaterländischen Verein, dessen Vorsitzender er wurde. Die Statuten dieses Vereins gaben als Zweck an, „für gesetzliche Freiheit zu wirken; insbesondere beharrlich fest zu halten an den, von der deutschen Reichsversammlung beschlossenen und von der obersten Reichsbehörde verkündeten Grundrechten, so wie an den weiteren schon erlassenen und noch zu erlassenden Reichsgesetzen; in gleicher Weise uns zur unverbrüchlichen Richtschnur zu nehmen, die Verheißungen des am 6. März 1848, für das Großherzogthum Hessen gegebenen Programms. Es soll daher unsere Aufgabe sein, vernünftigen Fortschritt zu erstreben, wahre Volksaufklärung zu befördern und der Willkür, in welcher Form sie erscheinen und woher sie kommen möge, entschieden entgegen zu treten.“ Am 6. März 1848 hatte Großherzog Ludwig II. Heinrich von Gagern zum Vorsitzenden des Gesamtministeriums ernannt. Mit Heinrich von Gagerns politischer Haltung stimmte Krauß noch bis in die 1860er Jahre im Wesentlichen überein. Im April 1849 unterzeichnete er zusammen mit anderen wichtigen Bürgern der Stadt, zu denen auch der Gymnasiallehrer Weyer gehörte, einen „Aufruf an die Einwohner Bensheims und der Umgegend“, in dem es darum ging, „unsere tapferen Reichstruppen […], welche das Vaterland gegen die herausfordernden Dänen in den Krieg schicken mußte“, mit Verbandsmaterial zu versorgen. Bernhard Krauß gehörte sicherlich zum gemäßigten und konservativen Flügel der Bewegung von 1848. In Wahlrechtsfragen allerdings plädierte der Bensheimer Vaterländische Verein für das allgemeine und gleiche Wahlrecht. Ende 1849 wurde Bernhard Krauß als Vertreter der konstitutionellen Richtung im Wahlbezirk IV. Bensheim in die zweite Kammer des hessischen Landtags gewählt.
Kleinkinderbewahranstalt und Höhere Töchterschule
In den 1850er Jahren intensivierte Krauß seine Bemühungen um eine Kleinkinderbewahranstalt sowohl im Ortsschulvorstand als auch im Gemeinderat, dem er inzwischen angehörte. Angesichts der sozialen Not lag dem Schulvorstand die Errichtung einer Kleinkinderbewahranstalt „schon seit vielen Jahren am Herzen“. Auch wird Krauß die Gründung einer Höheren Töchterschule im Jahre 1850 zugeschrieben, also der Schule, aus der 1858 das Institut der Englischen Fräulein, die heutige Liebfrauenschule, hervorging. Allerdings stammte der erste öffentliche Aufruf dazu von Frau Christine Brauneis geb. Ludwig.
Fortbildungsschule
Seit Mitte der 1840er Jahre bemühte sich Krauß zusammen mit Ortsschulvorstand und dem Gewerbeverein um die Errichtung einer „Fortbildungsschule“ – heute würden wir sagen: einer Berufsschule. Am 23. Februar 1847 stellte der Schulvorstand u.a. mit Pfarrer Bloesinger und Dr. Krauß beim Bensheimer Gemeinderat den Antrag, eine Winterabendschule einzurichten, und begründete ihn damit, „daß Bensheim vorzugsweise eine Gewerbsstadt ist, deren Wohlstand von dem Zustand der Gewerbe, diese aber von der Bildung der Gewerbetreibenden abhängt […].“ Bis 1863 sind im Allgemeinen Bergsträßer Verordnungs- und Anzeigeblatt von Krauß gezeichnete Anzeigen und Mitteilungen der Bensheimer Handwerkerschule zu finden.
Schulturnen
Im gleichen Jahr trat er als Organisator und Festredner einer Jubiläumsfeier des Gymnasiums auf. Dabei setzte er sich besonders für das Turnen ein und forderte, „daß noch ein eigener Turnlehrer am hiesigen Gymnasium angestellt wird und daß die Stadt eine eigene Turnhalle errichtet, damit das gesunde, den Körper und Geist kräftigende Turnen, das zugleich von manchem Schlimmen und Verkehrtem abhält, Sommers und Winters exercirt werden kann.“
Deutscher Reformverein und Reichsgründung
Ende 1862 gehörte Bernhard Krauß in Frankfurt zu den Mitgründern des Deutschen Reformvereins, für den er auch Heinrich von Gagern gewinnen wollte. Diese Gruppe versuchte, durchaus im Sinne der Regierung Dalwigk in Darmstadt, im liberal-konservativen Lager ein Gegengewicht zum preußisch ausgerichteten Deutschen Nationalverein zu bilden. Ging dessen Gründung auf den Erfolg der italienischen Einigungsbewegung zurück, so dass er eine stark antikatholische, gegen die ultramontane Partei gerichtete Politik vertrat, so verstand sich der Reformverein zwar nicht als „großdeutsch […], wenn auch großdeutsche Ideen den Verein prägten“, wie Krauß am 24. Oktober 1862 an Heinrich von Gagern schrieb. Überhaupt würde „jeder Parteianstrich […] nach meiner Ansicht der guten Sache [schaden], während der Ausdruck ‚ächt deutsch’ oder ‚patriotisch’ geeignet ist, alle Parteien zu vereinigen und schon deshalb manchen s[o] g[enannten] Kleindeutschen wie Nationalvereinler leichter bekehren und herüberbewegen wird.“ Tatsächlich war das ein erfolgloses Bemühen. Dem ebenfalls 1862 ernannten preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck gelang es wenig später den Nationalverein auf seine Seite zu ziehen und, von diesem unterstützt, die kleindeutsche Lösung bei der deutschen Einigung durchzusetzen.
Der „Kulturkampf“ am Ende seines Lebens
Es folgte die Zeit des Kulturkampfes. Sie prägte die letzten Lebensjahre von Bernhard Krauß. Und auch seine Beerdigung blieb davon nicht unberührt. So weigerte sich der Bensheimer katholische Pfarrer Sickinger, die Bestattungsfeierlichkeiten des am 19. Februar 1875 verstorbenen Bernhard Krauß zu übernehmen. Das Bergsträßer Anzeigenblatt veröffentlichte einen Nachruf, in dem es unter anderem hieß: „Der Verstorbene, ein feingebildeter Mann, hatte stets an allen Vorgängen des öffentl[ichen] Lebens den lebhaftesten Antheil genommen, mit idealer Begeisterung alle humanen Bestrebungen unterstützt und war namentlich für die religiös-sittliche Entwicklung und Erziehung der Menschen durch Wort und Schrift schwärmerisch thätig. […] Von ultramontaner Seite ward ihm im Stark[enburger] Boten die ehrenvolle Auszeichnung zu Theil, der Gegenstand fortgesetzter, roher Angriffe zu sein. Herr Dr. Krauß war katholisch, und hatte seine Zugehörigkeit durch seine Theilnahme an der Oster-Communion stets practisch bethätigt; nichts destoweniger erhielten dessen Angehörigen auf ihre Bitte, um Begleitung der Leiche, von Pfarrer Sickinger eine abschlägige Antwort, mit der Bemerkung, derselbe sei ein Feind der katholischen Kirche gewesen. […] Bereitwillig entsprach der altkatholische Pfarrer, Herr Rieks von Heidelberg, dem Wunsche um Begleitung der Leiche, und unter der theilnahmsvollsten Haltung der Bevölkerung, dem Vorantritte des hiesigen Kriegervereins und der Feuerwehr, und der Betheiligung des Gesangsvereins Harmonie, sowie des Direktors, sämmtlicher Lehrer und Zöglinge des Großherzoglichen Schullehrerseminars, bewegte sich ein Zug Leidtragender, wie ihn unsere Stadt noch nie gesehen, zum Kirchhofe.“
Matthias Gröbel